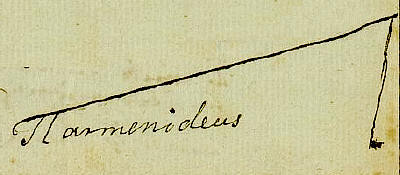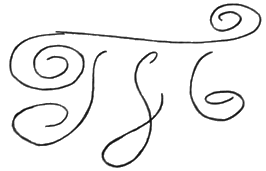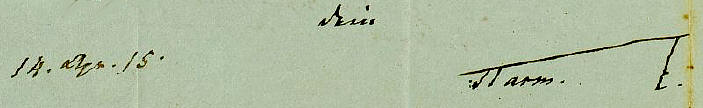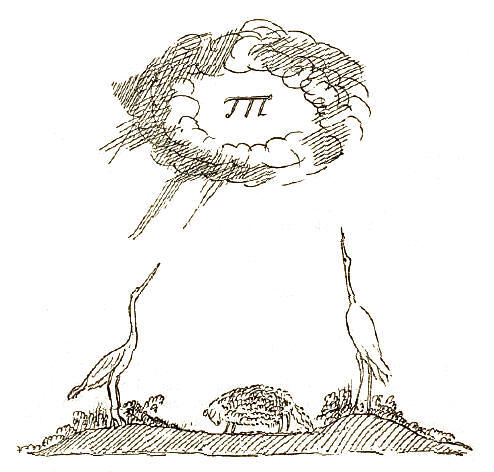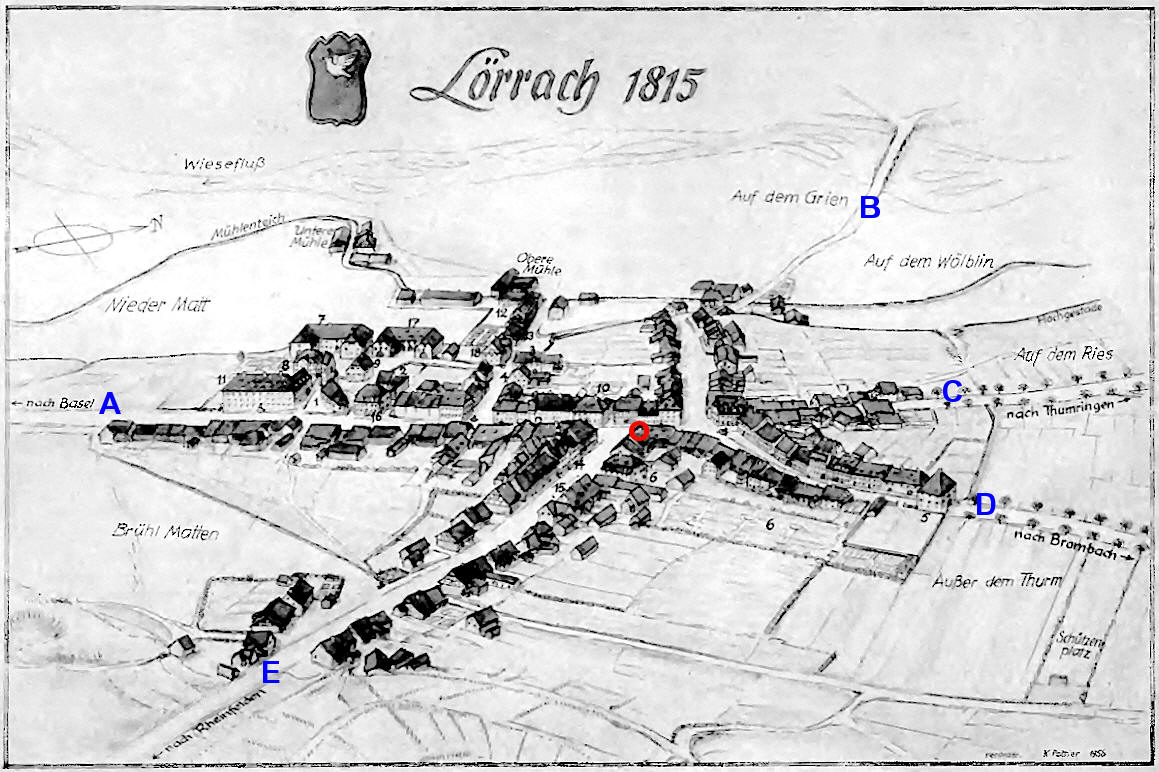|
|

zurück |
|
Der Proteuser-Bund - die
Übersicht |
 Federzeichnung Hebels aus dem Brief
an Hitzig v. Dez. 1811
Federzeichnung Hebels aus dem Brief
an Hitzig v. Dez. 1811 |
| |
|
|
Der Bund |
|
|
| |
|
|
Der GottSein Siegel / Symbol
Die Proteologen
|
Proteus

Parmenides
Diogenes Cÿnikus
Diogenes redivivus = Cynikulus
Die griechische Stoa
Aeiiudaeos / Ahasveros
Horatius Flaccus
Cagliostroi
|
der „Alte vom Meer“, der Gott der Verwandlung und des Nichts
(frühes
Griechenland).
(Ebenfalls
Hebels Zeichen
für sich selbst als Parmenides in seinen Briefen an F. W. Hitzig).
Parmenides aus Elea,
bedeutender griechischer Philosoph, Vorsokratiker, 5. Jhrt v. Chr.
Diogenes von Sinope (bekannt
als der "Diogenes in der Tonne"), 4. Jhrt. v. Chr.
Der Basler Buchbinder
Augustin Scholer.
Die erste Kongregation des
Proteus, eines der wirkungsmächtigsten philosophischen Lehrgebäude
in der
abendländischen Geschichte, seit ca. 300 v. Chr.
Der Ewige Jude, eine Figur
aus christlichen Volkssagen, a. d. 13. Jhrt.
Horaz - römischer Dichter
der 'Augusteischen Zeit' (30 v. - 14 n. Chr.).
Alessandro Graf von
Cagliostro (Pseudonym für den Hochstapler Giuseppe Balsamo), italienischer Okkultist, Alchemist und Abenteurer, 18. Jhrt.
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
Der Thron und Altar
Hymnus
Wappentier
Wappenschild
Hauptstadt
Treffpunkt
Mitgliederliste
|
Der Belchen
Ekstase
Stork
Proteus im Wolkenkranz
mit Storken u. Schwabenhammel
Proteopolis
oder "die heilige Proteusstadt"
Gasthaus "Zum Wilden Mann"
Die Matrikel
|
(keltisch: der Strahlende)
südlicher Schwarzwald, 1414 M. ü. Meereshöhe.
Hebel und Hitzig "entdeckten" den Berg 1791 - das Jahr, in dem sie ihn
gemeinsam 2 Mal bestiegen und den Gipfelrundblick bestaunten.
Phantasie über den
Proteuskult von Hebel und F. W. Hitzig, 1793 (der Entwurf dazu ev. 1790
begonnen).
Storch
Federzeichnung Hebels aus dem
Brief an F. W. Hitzig vom Dez. 1801.
Lörrach, im äußersten
Südwesten Deutschlands an den Ausläufern des südl. Schwarzwaldes
im Wiesental, damals [wie heute] ca. 3,5 km vom Dreiländereck Baden[D]/F/CH
entfernt.
1682 als seinerzeit
dritter Gastronomiebetrieb in Lörrach eröffnet. Die Traditions-Gaststätte existiert,
an der Ecke Baslerstr./Wallbrunnstr. bzw. am alten Marktplatz von Lö. gelegen, bis heute.
lt. Brief an F. W. Hitzig
vom Dez. 1793 von diesem geführt und aufbewahrt, heute verschollen.
|
| |
|
|
Der Ursprung |
Der "Amicisten-Orden" |
Zu Beginn des Studiums in
Erlangen trat Hebel in die Landsmannschaft der "Mosellaner" ein, nach ca.
einem halben Jahr wurde er in den engeren Kreis, den "Elsässer- oder
Amicisten-Orden" aufgenommen. *
|
| |
|
|
Die Mitglieder
|
|
[Incl. der von Hebel in
seinen Briefen als Netorecks bezeichneten Personen] |
| |
|
|
Vogt / BürgermeisterVögtin /
Frau des BM
Stabhalter / Stellvertr. des BM
Bammert / Feldhüter
"Oberpriester" [A]
|
Tobias GünttertKaroline Auguste
Günttert
Parmenides /
J. P. Hebel
August Welper
Zenonides /
Friedrich Wilhelm Hitzig
|
(1751 - 1821) seit 1779 Leiter des Pädagogiums in Lö., seit 1790 Pfarrer
in Weil.
(1762 - ?) geb. Fecht,
Ehefrau des Tobias G.
auch
 armenides,
Parm. und weitere Varianten (siehe hier) armenides,
Parm. und weitere Varianten (siehe hier)
(1770 - 1829) seinerzeit
Aktuar beim Oberamt Lörrach, später Oberhofgerichtsrat.
(1767 - 1849) Hebels
bester und lebenslanger Freund. 1791
Nachfolger Hebels am Lö. Pädag.,
1800 Pfarrer in Rötteln,
später in
Schopfheim und Auggen. Ab 1720 Abgeordneter des Badischen
Landtags in
Karlsruhe, deshalb endet der rege Briefwechsel auch um diese Zeit.
|
| |
|
|
"Stabspflichtiger" [B]
möglicherweise Mitglied
vermutliches Mitglied
vermutl. Mitgl. vermutl. Mitgl.
[C]
"unser neuer Proteuser"
Netoreck [D]
- Pathen Statthalter u. Netoreck [1]
- Cosefelicet-Natoreck [2/3]
Der Netoreck [2]
- Netoreck / Afternetoreck [4]
- Archinetoreck und
des älteren Netorecks [5]
- dem iungen Netoreck [6]
|
Karl Christian Freiherr von Berckheim
Friedrich Jutzler Wilhelm Engelhard
Sonntag
Christof Jakob Reinhard
ein 'Musikus Lehmann'
und diverse Basler Herren
Hubertus von Harrer
Stork / Storch
Ferdinand Sigismund Hitzig
entw. Jakob
Friedrich Eisenlohr
oder Eberhard
Frick
Jakob Friedrich Eisenlohr
Karl Ludwig Hitzig
Heinrich Sigmund Herbst
wahrscheinl. Karl
Friedrich Eisenlohr
|
(1777 in Lö. geb.) Schüler
von Hebel u. Hitzig am Lö. Pädag., Spitzname "Notteli". [B]
um 1790 Vikar in (Schopfheim-) Gersbach;
naheliegend, da "Jutzler" im Proteusischen "Begleiter" bedeutet.
(1762 -
1799) einst Kamerad Hebels am Karlsruher Gymnasium Illustre,
seit 1784 Vikar in
Kandern, von Hebel als "mein zuverlässigster Freund"
bezeichnet.
Pfarrer in
Tüllingen.
Angaben lt. W. Altwegg an Hand der Zeichnung von Ch. Meichelt
(Nähere Angaben oder Namen konnten bis heute nicht eruiert werden).
Hebel hatte den Mitarbeiter der
"Rheinischen Musen" (einer 1794 - 97 erschienenen Literaturzeitschrift)
nach eig. Worten im Juli 1803 - als "neuen Proteuser eingeweiht" - "eine
coseselige fidele Seele". proteische Verdrehung,
auch 'Natoreck'. In Hebels Briefen werden 6 Netorecks angedeutet:
(1775 - 1838) jüngerer
Bruder F. W. Hitzigs.
(siehe nächster Eintrag
'Der Netoreck'). Im Brief an Hitzig vom Juli 1802 ist die Zuordnung
nicht eindeutig,
im Brief vom Juli 1803 dagegen schon.
Zeichenlehrer am Lö. Pädag.
(1777 - 1856) 1801 - 1806 Präzept.-Vikar in Lörrach, ab 1819 ev. Stadtpfarrer in Freiburg, früherer Schüler
Hebels in Lö.
und "Theuerster Freund". Vom umfangreichen Briefwechsel ist lediglich 1
Schreiben erhalten.
(1783 - 1827) jüngster
Bruder des F. W. Hitzig, und dessen Schüler am Lö. Pädagogiums,
von 1805 bis 1809 Diakonus in Lörrach.
(1777 - 1843) Hebels
Schüler auf dem Karlsruher Gymnasium, später Hofmeister auf der
Kaltenherberge.
(1783 -1827) er hatte 1805
sein theologisches Staatsexamen in Karlsruhe bestanden.
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
- "ein unerkannter Proteuser" |
"Der Mann im Mond..." |
"...haut Reiser." - Aufgeführt im Hymnus "Ekstase".
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
"Steisibruser" (1) [E]
|
Martin Steinebrunner
|
der Sohn des gleichnamigen Wirts der "Sonne" in Wieslet, der Hebel
und Hitzig bei ihrer Besteigung
des Belchen als Bergführer begleitete
(deswegen 'Steisibruser' = "Begleiter" im belchischen Wortschatz).
Altwegg nimmt "den Wirt oder den gleichnamigen Sohn" an, lt.
Ortssippenbuch ist der Wirt jedoch bereits 1779 im Alter von 38 Jahren
verstorben - es kommt daher nur der Sohn in Frage. [F]
|
| |
|
|
"Steisibruser" (2) [F] |
Johann Jakob Renk |
(1783 - 1861) Seit 1812 Lehrer in
Neuenweg. er wurde 1815 nach Maulburg versetzt - möglicherweise hatten
Hebel und Hitzig ihn beim Versetzungsgesuch unterstützt, oder sie sogar
veranlasst (und durchgesetzt)
|
| |
|
|
Die Lehre |
|
|
| |
|
|
Zeitrechnung
Philosophie
Sprachsystem
Sprache / Wortschatz
Ergänzendes
|
Allmanach des
 auf das
auf das
gnadenreiche Jahr 1Grundstriche
des
 schen schen
Lehrsystems
Sprachsystem d. Proteus
Wörterbuch des Belchismus
Anhang
|
14 Kalenderblätter + 20 Paragraphen
3 Teile ('vom Proteus',
'Von der Welt', 'Vom Menschen insbesond.') mit 26 Lehrsätzen
nur [der Teil] "III.
Etymologie, 8tes Heft. (A. T.)" kann lt. 'Wörterbuch' als sicher
existierend
angenommen werden, jedoch ist er (wie auch die ev. vorhandenen weiteren Teile)
verschollen.
113 Worte, aufgeschrieben
von Hebel im November 1791
(+ 9 Worte, von Hitzig unbekannten Datums angefügt)
[+ ca. 50 weitere 'proteisch/belchische Wörter in Hebels Briefen an
Hitzig].
a) die Ankündigung eines "Catholikons"
(eines 'allgemeinen, umfassenden Wörterbuches') des Proteus (vermutlich
des 'Belchismus-Wörterbuchs') sowie einer Sammlung "Proteusscher
Flüche".
b) Eine Auflistung der Post-
und Diligence-Ankunfts- und -Abgangstermine in Proteopolis.
|
| |
|
|
Proteus & Belchen |
|
|
| |
|
|
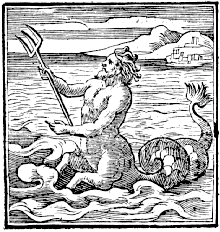 |
Proteus ist ein
Meeresgott, in Unterordnung zu Poseidon und manchmal als dessen Sohn
beschrieben. Allerdings ist aus der ganzen antiken bildenden Kunst kein
gesichertes Proteus-Bildnis erhalten. Proteus hütete Poseidons Robben
und andere von dessen Meeresgeschöpfen.
Er hat mehrere Wohnstätten, zu denen unter anderem auch die Inseln
Karpathos und Pharos gehören.
Als „ein anthropomorphes Symbol des Meeres“ besitzt Proteus wie auch
andere aquatische Gottheiten (Nereus, Glaukos, Phorkys)
deren drei markante Kennzeichen: das würdige Greisenalter (hálios géron,
„der Meeresalte“, so Homer, Odyssee 4,349), die Gabe
prophetischen Wissens (Divination) sowie die sprichwörtlich gewordene
Fähigkeit zur spontanen, polymorphen Gestaltverwandlung
(Metamorphose).
Darstellung: Jörg Breu; 16. Jhrt.
Bild und Text: Wikipedia
(gemeinfrei) |
| |
|
|
|
|
| |
|
|

|
"Der wahre Belchen oder
das Strasburger Münster aller Berge" (Hebel in einem Brief an Hitzig
1805, Nr. 137) "Ist
es wahr, daß die erste Station von der Erde zum Himmel auf dem Belchen
ist..."
(in einem Brief an Gustave Fecht 1795, Nr. 23) Der Belchen ist mit 1414 m
ü. NHN nach Feldberg, Seebuck und dem Herzogenhorn die vierthöchste
Erhebung des Schwarzwaldes.
Der Berg weist ein markantes, von der Oberrheinebene her nahezu
symmetrisches Profil mit einer baumfreien
Bergkuppe auf, diese besteht
aus Granit, wogegen die umgebenden Steilhänge überwiegend aus Gneisen
bestehen.
Er ragt aus dem Münstertal mit seinen zerfurchten,
ununterbrochenen Steilhängen etwa 1.000 m auf. Sein Nordhang
ist damit
der Bereich höchster Reliefenergie der deutschen Mittelgebirge.
Darstellung: Emil Lugo, Blick zum Belchen vom Untermünstertal aus, 1889;
Tusche und Pinsel.
Staatliche Kunsthalle, Kupferstichkabinett, Karlsruhe |
|
|
|

|
"Oebbe fahrsch au
d'Milchstroß uf in die verborgni Stadt... was siehsch?
...Der Belche stoht verchohlt, der Blauen au, as wie zwee alti Thürn,
und zwische drinn isch alles use brennt, bis tief in Boden abe...'s isch
alles öd und schwarz,
und todtestill, so wit me luegt...dört isch d'Erde gsi, und selle Berg
het Belche gheiße!"
(Die Vergänglichkeit, letzte Strophe) Nach Süden hin fällt der
Berg schroff gut 800 m tief in den Talkessel der Kleinen Wiese bei
Neuenweg ab.
Über den Gipfel des Belchen führt eine Kette gut erhaltener Grenzsteine
aus dem Jahr 1790. Diese markierte seinerzeit die Grenze zwischen dem
habsburgischen Vorderösterreich im Norden und der Markgrafschaft Baden
im Süden des Bergs.
Nach zwei gemeinsamen Besteigungen des Berges 1791 - zusammen mit seinem Freund
Hitzig von Neuenweg aus -
wird der Belchen zu einem zentralen Punkt in Hebels Denken und Wirken.
Darstellung: Arthur Schanzlin, Der Belchen im Schwarzwald, 1923;
Ölgemälde.
Krone und Kultur e. V. - Schleith-Atelier, Kleines Wiesental |
| |
|
|
Parmenides-Signets und -Unterschriften aus den Briefen an F. W. Hitzig |
| |
|
|
 Parmenides-Signet, Jan./Feb. 1791
(Briefanfang)
Parmenides-Signet, Jan./Feb. 1791
(Briefanfang)
 desgl. (Briefende)
desgl. (Briefende)
 Parmenides-Signet, 12. August 1808
Parmenides-Signet, 12. August 1808
|
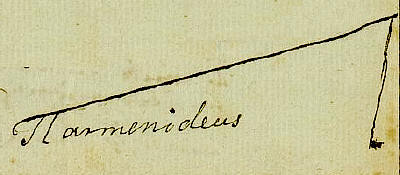
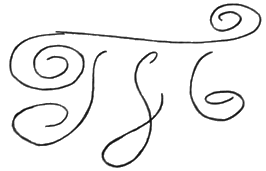
Unterschrift "Parmenideus", 3. Weinmonat (Okt.) 1804
Parmenides-Signet aus einem Brief
aus dem 'Nachlass Hitzig', verm. 1811
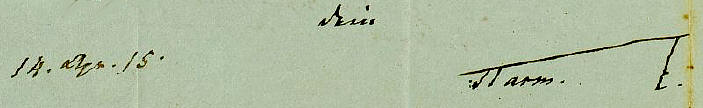
Unterschrift "Parm.", 14. April 1815
|
| |
|
|
Proteische Zeichen |
|
|
| |
|
|

Stork | Proteus |Zenonides| Parm. |Horatius|
Proteus | Stork

Parmenides |Zeno.| Proteus | Storkenflügel
| Proteus | Storken
| Proteus |Horatius| Parmenides
Zeichnungen Hebels aus dem Brief an F. W.
Hitzig vom August 1812
|
| |
|
|
Parmenides-Briefsiegel
|
|
| |
|
|
 |
Auf einem Brief vom 28. April 1799 an Johann Georg Lenz von der "Societät
für die Gesammte Mineralogie" in Jena findet sich nebenstehendes
Briefsiegel mit dem Zeichen des Parmenides. Da sich Hebel einen
Wachsstempel für das Briefsiegelwachs anfertigen ließ, scheint er viele
Briefe so gesiegelt zu haben. Da die Siegel beim Öffnen des Briefes
gebrochen werden, bleiben i. d. R. nur wenige erhalten.
|
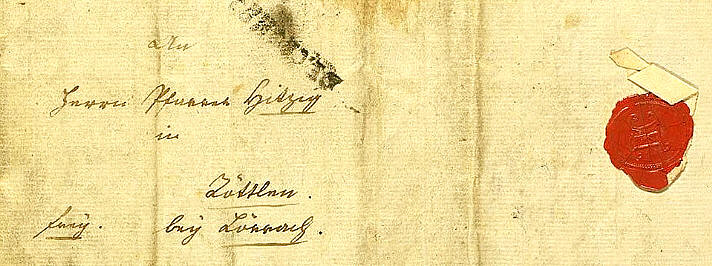 |
| |
|
|
|
|
Auf ca. 10 Briefen aus Hitzigs Nachlass finden sich Siegel- oder
Wachsreste die zeigen,
dass Hebel insbesondere
die Briefe an ihn mit dem Parmenides-Stempel gesiegelt hat.
Dies ist das
einzige vollständig erhaltene Exemplar auf dem Brief vom 14. April 1801.
|
| |
|
|
Abrakadabra-Heilsformel |
|
| |
|
|
a)
 [G]
[G]
b)  [G]
[G]
|
Ein Zusammenhang mit dem "Proteuser-Kult" und dem "Belchismus" ergibt sich
aus den den Zeilen in seinem Brief vom 25. Dezember 1795
an Gustave Fecht:
"Ist es wahr, daß die erste Station von der Erde zum Himmel der Belchen
ist und die zweite der Mond und die dritte der Morgenstern... Und hat er
[der Engel] Ihnen nicht von D. Brodhag erzählt?"
Die von Hebel unter die letzten Zeilen gesetzten Zeichen sind die
Geheimzeichen der ersten 3 Grade des "Harmonisten-Ordens" oder auch
"Orden der schwarzen Brüder", also die seiner beiden Gegner -
Runkel und Stork - in seinen
Duellen während seines Studiums (1. Grad = Stern, 2. Grad = Mond, 3.
Grad = Sonne).
|
| |
|
|
AABBRRAACCAADDAABBRRA
AABBRRAACCAADDAABBR
AABBRRAACCAADDAAB
AABBRRAACCAADDA
AABBRRAACCAAD
AABBRRAACCA
AABBRRAAC
AABBRRA
AABBR
AAB
A
|
AABBRRAACCAADDAABBRRA
AABBRRAACCAADDAABBR
AABBRRAACCAADDAAB
AABBRRAACCAADDA
AABBRRAACCAAD
AABBRRAACCA
AABBRRAAC
AABBRRA
AABBR
AAB
A
|
Abra-cad-dabra ist ein bei dem römischen Dichter Serenus Samonicus (um 200 n. Chr.)
erstmals vorkommendes Wort, das als magische Heilsformel benutzt wurde.
Als sog. Schwindwort, meist als gleichschenkliges Dreieck geschrieben,
kann es in dieser Anordnung nicht weniger als 1024 mal gelesen werden,
wenn man bei irgendeinem A beginnt und bis zum letzten A in der oberen
rechten Ecke fortschreitet.
Mögliche Herkünfte sind die aramäischen Wörter:
- avrah k'davra, was so viel wie „ich werde erschaffen, während ich
spreche" bedeutet. Abra von
'bra', bedeutet "schaffen", Ka "während" und Dabra ist die
1. Person des Verbs 'daber', "sprechen".
- Abra ka-Dabra, was
etwa bedeutet: „Es vergeht wie das Wort".
- Abda ka-Dabra, sinngemäß: „es geht zugrunde wie das Wort".
Dadurch, dass ein bestimmtes Wort
zum „Schwingen" gebracht wurde, glaubte man beispielsweise
Schmerzen lindern zu können.
Bei 'Brodhag' soll es sich um den exzentrischen Arzt Karl Friedrich
Brodhag gehandelt haben, der 1794 gestorben war und bei dem die
Anwartschaft auf das himmlische Jerusalem aufgrund seiner Ungläubigkeit
zweifelhaft war. Wahrscheinlich war dieser Brodhag ebenfalls ein "Schwarzer
Bruder", dem Hebel nach
seinem Tod durch die Verwendung der Heilsformel
die dortige Aufnahme ermöglichen wollte. Nach studentischem Brauch war
mit dem Tod des Gegners auch jeder Groll begraben. Hebel bekräftigt die
Formel mit seinem eigenen Proteus/Parmenides-Symbol.
|
| |
|
|
Proteische Korrespondenz |
Stammbucheintrag
für Hitzig vom 17. November 1791 |
| |
|
|
Die Entwicklung und Beschäftigung Hebels mit der
Proteuser-Philosophie beschränkte sich nicht auf die kurzen Jahre in
Proteopolis (Lörrach).
Dies wird deutlich, wenn man sich den Briefen widmet,
die er, über den langen Zeitraum von 1793 - 1821, häufig als Parmenides
an Zenonides - F. W. Hitzig schrieb
(dass danach keine Briefe mehr folgten, liegt
vermutlich daran, dass Hitzig als Abgeordneter der 2. Kammer des Bad.
Landtages sehr oft in Karlsruhe weilte, und der
persönliche Kontakt den brieflichen ersetzte). Da keine
an Hebel gerichteten Briefe seinen Tod, oder besser die Beseitigung
seines Nachlasses durch die Verwandtschaft
überdauerten, können wir leider keinen Aufschluss
darüber gewinnen, ob Hitzig in gleicher "proteusischer Terminologie"
geantwortet hat. Naheliegend wäre es schon,
da Hebel andernfalls wohl von der häufigen
Verwendung proteusischer Wörter und Anspielungen Abstand genommen hätte.
An dieser Stelle sollen nun nicht sämtliche Briefe oder
Briefstellen aus Hebels Schreiben zitiert werden (diese können im "Briefe-Ordner"
unter "Friedrich Wilhelm Hitzig"
alle nachgelesen werden) - ich möchte hier aber doch
einige der aufschlussreichsten Passagen anführen: |
| |
|
|
Dezember 1793
Januar — Februar 1797
Den 2ten August [18]00. |
Unterdessen hat
 auch
den Herrn von Edelsheim zu sich genommen. Der erste dumme Streich den auch
den Herrn von Edelsheim zu sich genommen. Der erste dumme Streich den
 begieng. Denn bey Gott! Bruder, er war nicht wofür ihn mancher im
Oberlande hielt, war überschwenglich mehr, als mancher giftige Geiferei
verstehen konnte, der bravste Mann nach dem Fürsten, wie der erste; der
humanste Mann, Freund des Marggraven, des Landes, des Verdienstes, der
Wissenschaften, des Bürgerstandes. Ich ehre ihn seit seinem Tode als
einen Urproteusen und bitte dich seinen Namen in die Matrikel
einzutragen.
begieng. Denn bey Gott! Bruder, er war nicht wofür ihn mancher im
Oberlande hielt, war überschwenglich mehr, als mancher giftige Geiferei
verstehen konnte, der bravste Mann nach dem Fürsten, wie der erste; der
humanste Mann, Freund des Marggraven, des Landes, des Verdienstes, der
Wissenschaften, des Bürgerstandes. Ich ehre ihn seit seinem Tode als
einen Urproteusen und bitte dich seinen Namen in die Matrikel
einzutragen.
Ich hab angefangen die Kantische Philosophie zu studiren, auf Anrathen
eines sehr gelehrten Ungarn, der sich hier aufhält, und laß es nun
wieder bleiben auf Anrathen Meiner. Sie sey dem Desegelisgeinet im
Augenblick seiner schlimmsten Laune preisgegeben mit allen Kategorien.
Es gibt nur ein System, nur eine Philosophie — Unsere! die sich von
allen andern wesentlich darinn unterscheidet, daß sie auf einem Grunde
ruht, in dem iene auf nichts, die unsrige aber doch wenigstens auf das
Nichts gegründet ist. — Wollen wirs nicht ausarbeiten und in der Form
eines Almanachs für 1798. Als eine Satyre aller Philosophie herausgeben
und sust näumis?...
...Adio! Helf uns Proteus! Es
leucht' uns der nächtl. Nimmerschein!

Den Netoreck werden wir
nun wohl als Pathen Statthalter in Proteopolis erklären müssen. Denn wegen
der Anciennität können wir ihn doch unmöglich zum Prenedisat erwählen
und ebenso wenig in einer geringeren Qualität ihn an den Altar des
 stellen. Instruir' ihn doch ein wenig im Ritus, und geh ihm an die
Hand, wo es ihm noch fehlt, und da der Candidat Eisenlohr von Brombach
ebenfalls ziemlich hoch hinauf gespalten ist, wie wärs, wenn wir ihn zum
Netoreck creiren thäten?
stellen. Instruir' ihn doch ein wenig im Ritus, und geh ihm an die
Hand, wo es ihm noch fehlt, und da der Candidat Eisenlohr von Brombach
ebenfalls ziemlich hoch hinauf gespalten ist, wie wärs, wenn wir ihn zum
Netoreck creiren thäten? |
| |
|
|
Anfang September 1802
Anfang — Mitte November 1802
Ende Juli 1803
September 1804
|
Ich verlasse Karlsr, am Sonntag vor Micheli mit Sander, Welper und
Fröhlich und gehe nach Hügelheim zu Schmidt an die Stuffen des großen,
Niebewegten, Wolkenspendenden. Von dort aus soll es mir gar nicht ab der
Hand und außer dem Sinne liegen, wenn der Genius mich anweht ihn gerade
zu erklimmen den Großen, Nimmerbewegten, Oechsleinseligen, und wenn ich
den Drekchdu und die Steissibruserie begrüßt, und Carolisens verwehte
Spuren gesegnet, und vom Rekapitulationsblütschi aus den Großen,
Weitgesehenen, Aethervertrauten noch einmal angebetet habe, eines Gangs
das Thal hervor zu metzgen und wie Odysseus den besoffenen Polyphem, so
ich den Kaps zu prügeln, und dann in Steinen den Dicken zu fragen, ob
der Steg über die Wiese stehe. Sollte mir aber der Deus in nobis als
einem durch 10iährige Verschwabenhamlung unrein gewordenen das
herumtalpen auf heiligem Boden vor der Reinigung im Tempel verbieten, so
werde ich auf der Straße der Schwabenhämmel nach Hertingen aber metzgen,
bey dem Chatz mich noch einmal ganz erschröcklich verschwabenhammeln,
über Candern nach Wisleth gehn und den Kaps doch prügeln, dann die
heilige Bahn durchschneiden und in Hausen bey den Flußspatöchslein
Quarantäne halten, dann in Schöpfen sie einige Tage fortsetzen, das
Haupt in der Wiese waschen und endlich mich dem Priester zeigen. Selige
Stunde der neuen Belebung und des Eintauchens in die heiligsten Gefühle
in der Umarmung des Lieben und Theuren, das heißt, Deiner! Von da
gedenke ich, wenn in einer guten Stunde der Ostwind nicht weht, das
heißt wenn nicht die Luft vom Grabe des Pfeddelbacher Oberhammels
neuerdings profanirend über die Thumringer Straße wandelt, nach
Proteopolis um den Gräuel der Verwüstung an heiliger Stätte zu sehen,
dann nach Basel zu wallen, um mir als Reliquie einen Span von der
äußersten Hülle des Cynikulus herabzuschneiden, in Weil das Diarium
meiner Wallfahrt nach dem Rekapitulationsgesez niederzuschreiben, und
dann endlich selbst rekapitulirt das h. entsündigt, geheiligt, veräthert,
für nimmer lange, nur um mich in die Glorie meiner Proteusischen
Widergeburt noch eine Zeit lang sichtbar zu zeigen, in die
Welschkorndichten, von keinem Oechslein besuchten Sandfelder
zurückkehren — nicht mehr ein langsam weidender Schwabenhammel, sondern
ein Metzger von kurzer Erscheinung.
Mein Jutzler auf dieser Reise wird ein leichter Mastelnack seyn. Welch
ein Fluch dieses klotzigen Herumtreibens immer mit Materie bepackt und
von ihr verfolgt zu seyn! Ich gedenke daher von Hügelh. aus den
Mastelnack seine eigenen Wege gehen zu lassen und den KR. Sander zu
bitten daß er ihn in K[alten] Herberg im Vorbeyfahren in den
Postchaisenkorb werfen solle, und wenn alsdann das Vieh, nemlich der
Mastelnack ein halbes Quintlein Vernunft hat, so wird er in Thumringen
selbst an Land steigen und nach Rötteln hinaufgehn um mir, wenn ich
nachkomme die allemanischen Lieder herauszugeben, die ich gern scharf
recensirt von dir haben möchte, damit du sie in der Folge wenn sie mit
dem Preßbengel am Hals in der Welt herumlaufen, desto glimpflicher
recensiren könntest...
...O die heiligen Buchen, und o die dämmernden Halden, und der
Wolkenverwandte Altar, und der schweigende See, und die Oechslein umher,
und das alternde Bebi und der dreckige Drechdu, und Carolisens Laube,
und alle Zeugen unseres freundlichen Beysammenseyns und unserer
lieblichen Thorheit! Warum bin ich nicht mitgekommen? Warum? Weil mich
Desegelesgeinets Bande halten, weil ich im Schatzwäldgen (du hast ia
Wucherers Relation darüber in der Zeitung gelesen) herumgeistete, und
das hinzugelogene Schwefelquell'gen suchte, und auf Rüppurs
Spätiahrsfluren Brach-Rüebgen fraß — ich Schwabenhammel!
Aber soll die Sonne, die iezt alle Abend tiefer und gerötheter in die
Wolken sinkt, noch einmal steigen, und ich will ewig ein Schwabenhammel
bleiben, und mit dem Pfeddelbacher an einer Suppe fressen und aus einem
Kübel saufen, wenn ich nicht komme, und den Frühlingsthau von den
Buseröris des Altars lecke, und mich Widergebohrnen und Enthammelten in
deine heilige Priesterarme werfe...
...Duke est desipere. Ich habe vorige Woche und zwar in einer WeinKneipe
zu Bruchsal nachts um 1 Uhr einen neuen Proteuser eingeweiht, den
Hubertus von Harrer, der für Basseltang nach Astracan reist, ein großes
Genie, ein feuriger Mensch, und eine coseselige fidele Seele. Ja der
Proteus weiß es, wir waren Abends um 6 Uhr schon im dritten Wirtshaus,
und dort gefiel es uns, weil wir allein waren, und blieben bis Nachts um
2 inter plena pocula und unter den stillen Flüchen der schlafseligen
Wirthinn, die uns ohne es zu wissen manchen proteusischen Segen gab, Z.
B. daß wir beym Teufel wären, daß sie uns nie gesehen hätte, daß wir
wären wo der Pfeffer wachst, daß wir am ersten Glasvoll erstickt wären,
oder auf dem Wege den Hals gebrochen hätten...
...Gerne, gerne kam ich in wenigen Wochen selbst zu euch, ihr Guten, um
froh und coseselig bey euch zu seyn, und über das und andres mit dir zu
sprechen und zu schnackein. Aber zu anderen Abhaltungen kommt dismal
mein Auszug, der in die Ferien fällt, und den ich kaum würde verschieben
können, weil auf mein Logis alsdann schon wieder ein anderer wartet.
Einmal werde ich euch doch wiedersehen und begrüßen ihr heiligen Haine
des Proteus ihr lieblichen heimischen Auen, ihr guten Menschen darinn,
und dich zum erstenmal, du kleine zirpende Proteuserinn. Küsse und grüße
mir sie und die Mutter, und nimms an dir selber ab, was dein Nächster
gerne hat, wenn ich dir dismal zu lange nicht geschrieben habe.
Mit gutem Blut und Herzen Dein Parmenid. |
| |
|
|
3. Weinmonat (Oktober) 1804 |
Gott segne Euch den Herbst, nicht nur mit viel Trauben und süßem Monet,
nos ederes auceh kèrimit nünnes Frâudes, used fero hem gesunez den
Weisen vos asso 1804. is dreinnig Jahrâs used drüber.
|
| |
|
|
D. 26ten Februar 1805
24. — 27. April 1805
d. 21. Aug. 1806
den 30ten August 1807
d. 6ten Apr. 1809
|
...Lebe wohl du gattiger
Proteuser in den Freuden deines auflebenden Frühiahrs um dich her und
grüße mir den ersten Pelargen. Oder wenn ich selber einmal quer über das
Wiesenthal fliege, so schau mit deiner Daube und dem Däublein freundlich
zum Fenster hinaus und schieß nicht deinen J. P. Parm.
So war ich denn auf dem Belchen aller Kirchthürme und hatte fast immer
von einem wunderlichen Sehnen angezogen das Auge im Süden. Aber der
wahre Belchen oder das Strasburger Münster aller Berge war in proteische
Dünste verhüllt und, während ich auf der Kirche stand, warst du
vermutlich drinn, denn es war Carfreitag. Doch grüßt ich euch unbesehen
über Berg u. Thal, und das war schön von mir ...
Bald lern ich dir ab, mein Theuerster, wie man der Ober-Postamtskasse
durch Verzögerlichkeit der Korrespondenz die Revenuen schmälert, ist
aber nicht bös gemeint, und kein Mensch anders dran Schuld als der
Dengelngeist in Trägheitsgestalt, denn gleich wie Proteus sich in alle
Gestalten wandelt, so thut auch, so weit seine Macht nicht gebunden ist,
sein Gegner der Denglengeinet und erscheint bald als Rheinisches Bundes
Haupt, als hessischer General, als Fliegenschwarm der mich ganz
entsetzlich mißhandelt, als Regimentstambour der mich fast zu tod
trommelt, und wieder als Trägheit, Zaghaftigkeit, Coelibat und
Ohrenbeicht, Freßdrang, Fischsucht und Floßkraft, Wakelzahn,
Promotionsmaxime, Krugbier. Kurz ich lebe, webe und bin in ihm, aber
lebt in mir, ohne welche Repugnanz des Innern Prinzips gegen das äußere
ich schon lang in Dengelnschall aufgelöst wäre, und allnächtlich auf dem
Feldberg durch die Lüfte ertönen müßte...
Sage mir, o theuerster Pränideset, was für ein proteiischer Planet es
sey, der dieses Jahr regirt, und die Trauben kocht, und die Dintenfäßer
austrocknet? Das meinige hat kaum noch Flüßigkeit, daß ich dich grüßen,
und dir sagen kann, daß ich noch lebe, oder eigentlich noch vegetire,
und bis zu den drei Männern im feurigen Ofen hinein, und bis in den
entsetzlich heißen Schoß des Proteus hinein dich liebe...
...Wenn die theol. Gesellschaft noch bestünde so hätte ich ihr dismal
einen Aufsatz über den Polytheismus geschrieben. Ich gestehe dir — denn
eine Beicht unter Freunden ist so heilig, als die am Altar, daß er mir
immer mehr einleuchtet, und nur die Gefangenschaft, oder Vormundschaft,
in welcher uns der angetaufte und anerzogene und angepredigte Glauben
behält, hinderte mich bisher den seligen Göttern Kirchlein zu bauen.
Unser dermaliger philosophischer Gott steht, fürchte ich, auf einem
schwachen Grund, nemlich auf einem Paragraphen, und seine Verehrer sind
vielleicht die thörichtesten Götzendiener, denn sie beten eine
Definition an, und zwar eine selbstgemachte. Ihr Gott bleibt ewig ein
Abstraktum und wird nie concret. — Als man zur Zeit der Bibel nur ein
paar Cubikklafter vom Weltall kannte, war es keine Kunst sich mit Einem
Gotte zu begnügen, und ihn menschlich zu lieben, weil man ihn menschlich
denken konnte. Und doch konnte selbst der sanktionirte Monotheism. nur
mit Zwang und nie mit Glück den Götterglauben und die Anbetung derer,
die uns näher sind, als der einzige, ewige unerfaßbare über den Sternen
entfernt halten. Ich möchte mich gerne mit einem oder einigen Göttern
dieser Erde begnügen, die um uns sind, die uns lieben und beobachten,
die unsre Blüthenknospen aufthun, unsre Trauben reifen, denen wir trauen
können, und die sich lediglich nichts darum zu bekümmern haben, wer für
die andern Sterne sorgt, so wenig als wir. Sie sollen nicht allmächtig,
nicht allweise nur mächtig und weise genug für uns seyn, nicht souverain,
sondern untergeordnet einem noch mächtigeren und weisern, um den sie,
nicht wir uns zu bekümmern haben. Sie sind vielleicht schon so oft
erschienen, den Juden und Griechen, beiden in der Gestalt und Form in
der sie ihnen erfaßbar waren, dort Engel, hier Dämonen; sie würden
vielleicht auch uns noch eben so wie ienen wahrnehmbar seyn, wenn wir
nicht durch den Unglauben an sie die Empfänglichkeit ihrer Warnehmung
verlohren hätten. Das Organ dazu ist in uns zerstört. Wir haben ihnen
keine einzige Form mehr übrig gelassen, in der sie uns erschaubar werden
könnten...
|
| |
|
|
Mitte Juni 1809
4ta Calend. Pisteos. [4. Nov. 1809]
|
Nun trit einmal ein par Schritte näher, o Zenoides, der du mich schon
zum voraus dauerst, und laß dich waschen und fegen, und ganz entsetzlich
mißhandeln, du dintenloser, ungefederter, papirscheuer Sterblicher! Du
Siebenschläfer, nenne ich dich, du Neuntöder meiner Geduld, du
Pelagianer, du Sabellianer, du Patriot, du Anabaptist, du Rosenkreutzer,
du unproteischer Antichrist. Ach daß ich dich auch einen Utraquisten
nennen könnte, z. B. einen der zwey Hände hätte, oder an beiden Orten
zugleich seyn könnte, im Schwanen zu Lörrach im Fleisch, und zu
Carlsruhe im Wort, oder wenigstens nur an einem Ort. Aber gesteh mirs!
du existirst nicht mehr, bist aufgenommen von dem Proteus in
reines, klares
offenbares
nie empfundenes
nie gewesenes
Nichts
entwoben, zerstoben,
im Glanze seines Angesichts.
Deinem Busen näher
Vater der Proteer
innig von dir angezogen
geistig von dir eingesogen,
Urrein, ganz dein.
Hörst du die Schwingen der Zeit?
Siehst du die Cyklen
sich um den Webbaum des Nimmerseyns wicklen,
stets fliehn das seelige Heut?
O Lieber!
Warum hast du vernagelt den Schieber
nd schauscht nicht aus deiner heimlichen Claus
ein Stündlein zu deinem Parmenis heraus.
Ich komme! da bin ich!
Und hau' ihn entzwey mit dem Hieber.
Alle Hagel!
Hier ein Fetzen!
Dort ein Nagel!
dein Entsetzen
mag mich wundersam ergetzen.
|
| |
|
|
D. 4ten .
[3. Dez. 1809] .
[3. Dez. 1809]
|
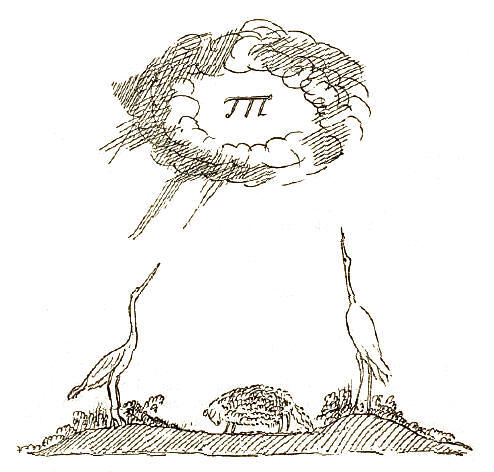
(Die Zeichnung befindet sich auf der Rückseite des
2. Blattes)
|
| |
|
|
Anmerkungen |
|
|
| |
|
|

J. P. Hebel
Bado Mosellanus
Titelblatt des Stammbuches
mit dem
gelöschten Amicisten-
Geheimzeichen
|
*
Hebels Beitritt zu den
Mosellanern und die Aufnahme in die Amicisten waren verbunden mit
diversen feierlichen Zeremonien, "verbindlichen" Ritualen, einem
pflichtgemäßen Eintreten für die Gemeinschaft, aber auch mit tollen
Ausgelassenheiten und übermütigen bis derben Studentenstreichen, die
einen tiefen Eindruck machten - und die, wie die Briefe an Hitzig und
die Fam. Hauffe zeigen, eine lebendige Erinnerung für das ganze Leben
hinterließen. Daher dürfen wir annehmen, dass die Wurzeln der Proteuser
in Erlangen lagen: hier wie später in Lörrach gab es einen "Geheimbund"
mit "Siegel", "Geheimsprache", "Geheimzeichen & -schriften, Regularien,
Decknamen für die "Ordensbrüder" - entnommen der römischen und
griechischen Geschichte und Mythologie - u. v. m. Wahrscheinlich war
auch Günttert, der 'Vogt', Angehöriger der Mosellaner und Amicisten
(wenn auch an einer anderen Universität) und so haben sich beide in
Lörrach auf der Basis des gemeinsamen Studentenerlebens wieder gefunden.
(Zusammengefasst nach einem Beitrag für den Markgräfler Geschichtsverein
von Friedrich A. Pieztsch,
Heidelberg - zum vollständigen Artikel
hier)
Ursprünglich
zwei gegeneinander gestellte und in sich verschlungene C für die Losung
des Ordens "Vivat unus, vivant omnes" = "Einer für Alle,
Alle für Einen" sowie die ineinander geschobenen Buchstaben 'A' und 'V'
 in der Bedeutung "Amicitia Vera" = Wahre Freundschaft. in der Bedeutung "Amicitia Vera" = Wahre Freundschaft. |
| |
|
|
[A] Von Friedrich Becker 1860 in "Die Basler Festgabe" so 'tituliert'
und von W. Altwegg bestätigt.
[B] Der spätere
Staatsminister und Präsident der Generalsynode von 1821 zur Vereinigung
der lutherischen mit der reformierten Kirche, war ein strenger
Vertreter des
staatskirchlichen Systems und der härteste Widersacher Hebels, der für
kirchliche Selbstverwaltung und Mitbestimmung eintrat. Letztlich
setzte sich Berckheim mit
Rückendeckung des Großherzogs durch. Nichtsdestotrotz wurde Hebel der
erste Prälat der vereinigten badischen Landeskirche.
[C] Proteuserbund (bei der Kirche von Rötteln) - von Christian Meichelt, 1812: lt.
Wilhelm Altwegg: ...sind der 2. v. li. ein 'Musikus
Lehmann',
die anderen
mehrheitlich Basler
Herren... - die Namen wollte Altwegg eruieren und später nachliefern.
Dazu kam es nie: entweder wurde er nicht fündig oder
er konnte die Aufgabe bis
zu seinem Tod 1971 nicht mehr in Angriff nehmen. In Hebels Briefen an
Hitzig lassen sich 2 Namen finden, die dafür
in Frage kämen (dies ist
natürlich hochspekulativ, zudem kam Meichelt erst 1798 nach Lörrach, er
kannte die Szene daher nur vom Hörensagen):
- Samuel Flick,
Buchhändler in Basel. Das proteusische Wort "Felicek" ist eine
Verdrehung aus 'Flick'. (Er gründete 1803 in Aarau eine Filiale, für die
er
Heinrich R.
Sauerländer als Geschäftsführer einstellte, der 1805 die Buchhandlung
selbständig übernahm und ab 1820 die "Alemannischen Gedichte" druckte.
- Johann Jakob von Mechel
(1764 - 1816), Maler und Kupferstecher in Basel. (Er unterhielt auch in
Lörrach eine Stecherwerkstatt, im Hinblick auf sein Alter
aber sicher erst nach der
'Proteuserzeit'.
[D] Unter Netoreck
oder Natoreck versteht Hebel lt. W. Zentner einen jungen Mann aus dem
heimatlichen Wiesental, der gewissermaßen erst
die niederen Weihen des Proteus empfangen
hat. Für die oben genannten, von Hebel in seinen Briefen angedeuteten
(wenn auch nicht namentlich
genannten) [1], [2], [3],
[4], [5], [6] mag das stimmen - für Zentners These,
dass Hebel alle jungen Männer aus dem Oberland als Netorecks
bezeichnete,
konnte ich in den Schriften und Briefen keinen definitiven Beleg
finden.
[E] Zur Person
des 'Steisibruser' existieren 3 Angaben:
1. die o. a. von Wilhelm Altwegg
stammenden Angabe betreffend M. Steinebrunner (klingt wegen der
Begleitumstände plausibel).
2. der von Hebel in 2
Briefen erwähnte J. J. Renk (siehe [F] - deshalb ebenfalls plausibel).
3. lt. W. Zentner sei es
ein Bauer aus Neuenweg gewesen (dies ist jedoch höchst unwahrscheinlich
und Z. gibt auch keine Quelle dafür an).
M. Steinebrunner wird
hier aufgeführt, obwohl er sicher kein Mitglied bei den Proteusern war,
aber offensichtlich für Hebel und Hitzig als Führer und
Begleiter (siehe
Wörterbuch des Belchismus) auf ihren Wanderungen zum Belchen eine
wichtige Rolle spielte.
[F] J. J. Renk,
der 'Steisibruser von Neuenweg', Lehrer in
Neuenweg (Kleines Wiesental) seit 1812, er wurde, wohl auch mit Hebels
und Hitzigs Unterstützung
1815 nach Maulburg
versetzt (Warum ihm Hebel die Ehre antat, ihn als "Steisibruser" zu
bezeichnen, ist nicht zu ermitteln).
[G] Von W. Zentner liegen 2 Widergaben vor: a) aus dem 2-bändigen Werk
von 1957 mit dem Davidstern (Hexalpha) und b) aus dem 1-bändigen Werk
von 1976
mit dem Pentagramm (Drudenfuß).
Welche von beiden korrekt ist, kann ich, da die Originale nicht
zugänglich sind, nicht entscheiden (Jedoch verwendet auch
Friedrich A, Pieztsch,
Heidelberg in einem Beitrag für den Markgräfler Geschichtsverein die
Version mit dem Davidstern).
|
| |
|
|
Proteopolis |
Die Hauptstadt |
|
| |
|
|
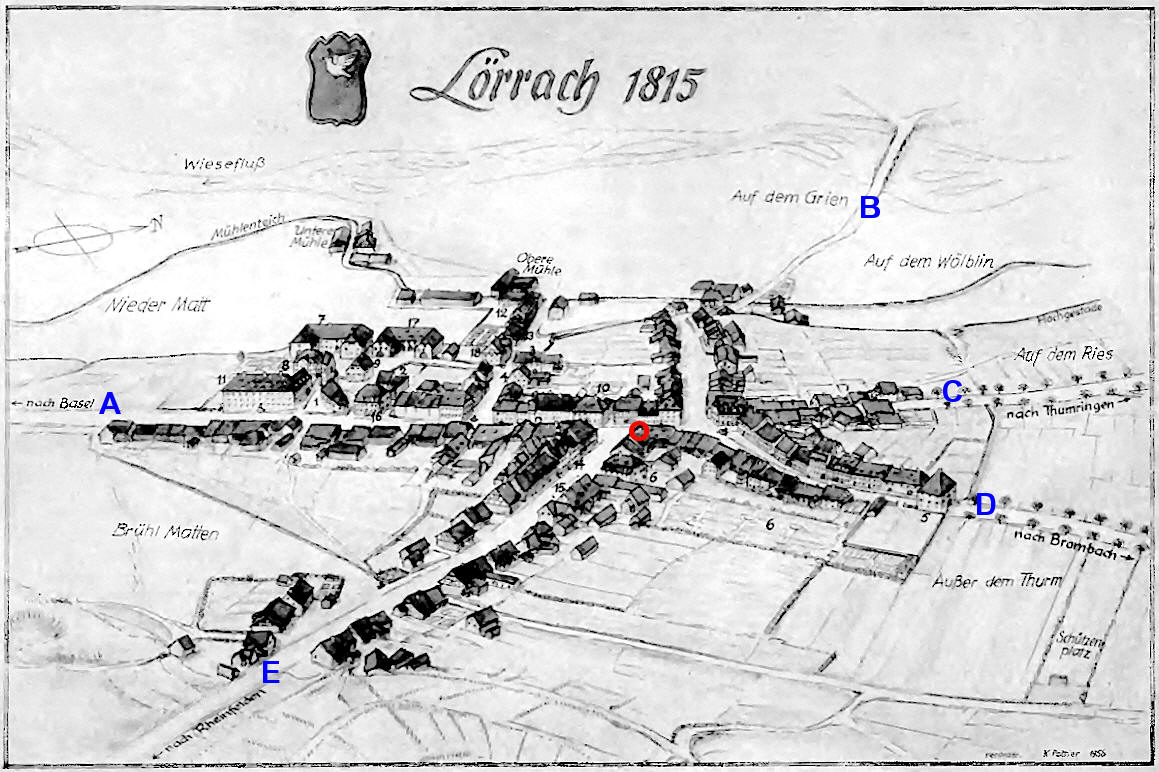
o
= Das Gasthaus "Zum Wilden Mann" -
Treffpunkt der 'Proteologen'

A
Baslerstraße (über Stetten und Riehen nach
Basel)
B
Teichstraße / Wiesebrücke (über Tüllingen nach Weil (von
dort weiter zur Kaltenherberge sowie nach Freiburg
und Karlsruhe)
C
Tumringerstraße (nach
Rötteln, Röttlerweiler und zum Röttler Schloß; ebenfalls über die "Lucke"
und Binzen zur Kaltenherberge sowie nach Freiburg und Karlsruhe)
D
Turmstraße (bis Nr. 5),
anschließend Brombacherstrasse (ins Wiesental nach Schopfheim (und zum
Feldberg) sowie nach Tegernau und zum Belchen)
E
Wallbrunnstraße (ins
'Schweizer' Rheinfelden (das Badische gab es damals noch nicht) sowie den
Oberrhein hinauf bis Konstanz und dem Bodensee)
Das Bild zeigt eine Ansicht von
"Lörrach 1815", es ist jedoch aufgrund der Baujahre der genannten
Gebäude klar, dass die Stadt schon zu
Hebels Aufenthaltszeit in den
Jahren 1783 - 1793 (bis auf die 'Weinbrenner-Epoche') genau diesen
Anblick geboten hat. An der Struktur
der Innenstadt - dem
asymetrischen + geteilten 5-strahligen Stern beim Gasthaus "Zum Wilden
Mann" als Ausgangspunkt
der 5 wichtigsten Strassen hat sich
bis heute nichts Grundlegendes geändert.
|
| |
|
|
|
|
|
| |

zurück |
|
nach
oben
1.
die "Proteische
Zeitrechnung"
2. das "Lehrsystem des Proteus"
3. das "Verzeichnis der berühmtesten Proteologen
älterer u neuerer Zeiten"
4. den "Anhang"
zum Almanach des Proteus
das "Wörterbuch des Belchismus"
der Hymnus
"Ekstase"
der
Hymnus "Ekstase" - Version ohne Autograph"
Der Hymnus "Ekstase"
- Entwurf / 1. Fassung -
|
| |
|
|
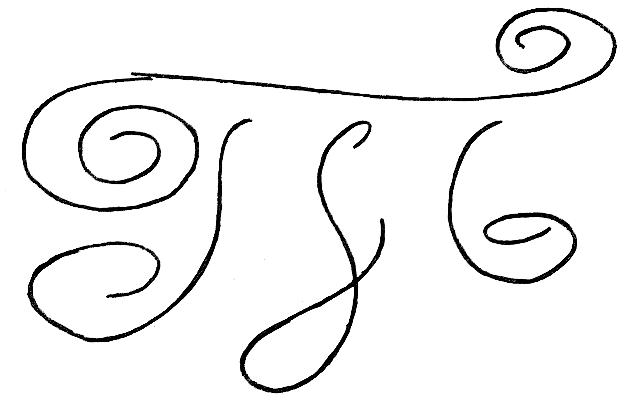 |
| |
|
|
|

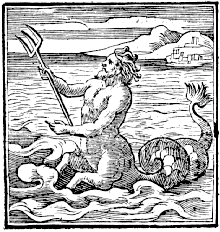



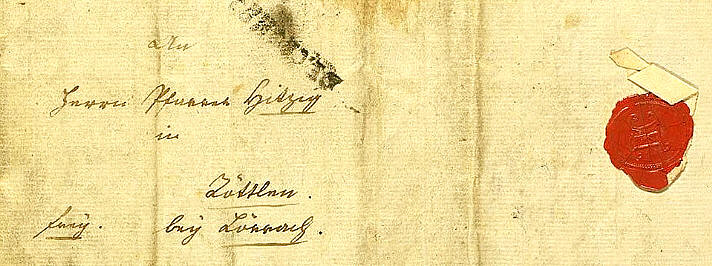


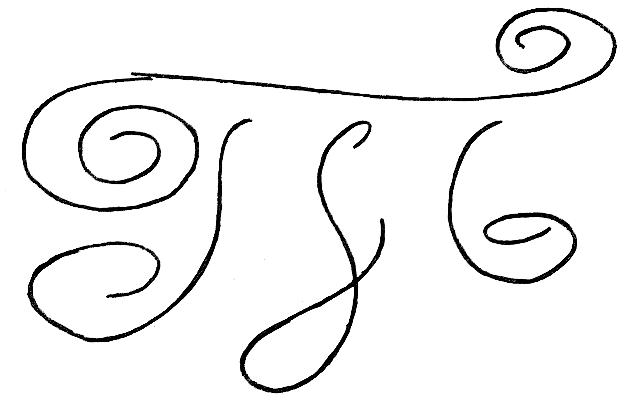
 Federzeichnung Hebels aus dem Brief
an Hitzig v. Dez. 1811
Federzeichnung Hebels aus dem Brief
an Hitzig v. Dez. 1811 Parmenides-Signet, Jan./Feb. 1791
(Briefanfang)
Parmenides-Signet, Jan./Feb. 1791
(Briefanfang) desgl. (Briefende)
desgl. (Briefende) Parmenides-Signet, 12. August 1808
Parmenides-Signet, 12. August 1808