 |
Briefempfänger in Texten und Bildern | ||||
|
zurück zur Briefübersicht zurück zu den Einzel-adressaten |
 Gustave Wilhelmine Fecht am 22. 8. 1768 als zweites von insgesamt 10 Kindern des Pfarrers von Eimeldingen Martin Fecht und seiner Frau Karoline Magdalene. Ende der achtziger Jahre übersiedelten Güntterts Schwiegermutter, Karoline Magdalene und Gustave zunächst ins Lörracher Kapitelhaus. Hier traf Hebel erstmals die "Jungfer Gustave" - täglich begegneten sie sich am Mittagstisch im Pädagogium. 1790 übernahm Günttert die Pfarrei im nahen Weil, ihm folgten Schwiegermutter und Schwägerin ins Weiler Pfarrhaus, in dem sie bis zu seinem Tod rund 30 Jahre zusammen verbrachten. Sie lebte in Weil, bis sie am 23. April 1828, nur 19 Monate nach Hebel, starb. 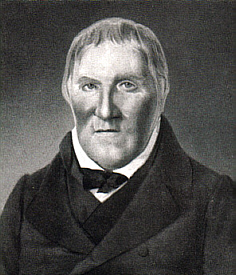 Friedrich Wilhelm Hitzig, er entstammt einer alten oberbadischen Pfarrerdynastie. Er wurde 1767 zu Bischoffingen am Kaiserstuhl geboren. 1771 erhielt sein Vater die Pfarrei Rötteln im Wiesental. Ab 1774 besuchte der junge Hitzig das Pädagogium im nahen Lörrach, 1782 wurde er Schüler am Karlsruher Gymnasium, 1785 bezog er die Universität Jena. 1787 bestand er, ein Zwanzigjähriger, das theologische Staatsexamen mit Auszeichnung. Die Freundschaft mit Hebel datiert aus den Lörracher Präzeptoratsjahren des Dichters, in denen Hitzig als Pfarrvikar seinem Vater in Rötteln zur Seite stand. Als Hebel 1791 nach Karlsruhe ging, wurde Hitzig sein Amtsnachfolger am Pädagogium in Lörrach. Tobias Günttert, 1751 als Sohn eines Chirurgus in Laufen geboren, hatte seine theologischen Studien an Waisenhaus und Universität Halle vollendet. 1779 fiel ihm die Leitung des Pädagogiums in Lörrach zu. In seiner Eigenschaft als Prorektor wurde er Vorgesetzter des Präzeptoratsvikars Hebel. Die dienstlichen Beziehungen verwandelten sich bald, zumal Hebel am Mittagstische des Schulleiters teilnahm, in lebenslängliche herzliche Freundschaft.  Sophie Haufe, 1786 - 1864, Ehefrau des Christof Gottfried Haufe, beide zum Straßburger Freudeskreis gehörend. Um sich brieflich an sie wenden zu können, ernennt Hebel sie zu seinem „lieben geheimen Staatsminister und Intendanten der Künste und Wissenschaften".  Friedrich August Nüßlin. Der ehemalige Schüler Hebels (1780 als Sohn eines Pfarrers in Weisweil geboren, gestorben 1864 in Mannheim) ist im Laufe der Zeiten zu einem seiner vertrautesten Freunde geworden. Nach kurzer Lehrertätigkeit in der Schweiz und am Pädagogium in Lörrach wurde Nüßlin 1807 an das Lyzeum in Mannheim berufen, wo er, ein hochangesehener Schulmann, zum Leiter der Anstalt emporstieg, die unter ihm zu hoher Blüte gelangte.  Karl Christian Gmelin (* 18. März 1762 in Badenweiler; † 26. Juni 1837 in Karlsruhe) war ein deutscher Botaniker und Naturforscher. Sein offizielles botanisches Autorenkürzel lautet „C.C.Gmel.“ 1784 ließ er sich in Karlsruhe als Arzt nieder, versah indessen gleichzeitig den Unterricht der Naturgeschichte am Gymnasium. 1794 fand er seine Frau in Christine, geb. Herbst, der „kreuzbraven Frau Doktorin" der Hebelbriefe.  Henriette Hendel-Schütz, * 13. Februar 1772 in Döbeln, Sachsen; † 4. März 1849 in Köslin, Provinz Pommern war eine deutsche Schauspielerin und Pantomimin. Als Sechsunddreißigjährige eroberte sie im Spätherbst 1808 bei einem Gastspiel in der badischen Residenz als Künstlerin und Mensch das Herz des Dichters. Sie soll bis an ihr Lebensende 1848 mit Vorliebe Hebels Gedichte vorgetragen haben. Die von ihm verehrte Künstlerin wurde im „Rheinländischem Hausfreund" zu einer stehenden Figur, der „Schwiegermutter des Adjunkten", und zur Widmungsträgerin des „Schatzkästleins".  Friedrich Karl Julius Schütz (* 31. Mai 1779 in Halle (Saale); † 4. September 1844 in Leipzig) war ein deutscher Historiker. Schütz begleitete seit 1811 seine Gattin, die Schauspielerin Henriette Hendel-Schütz auf ihren Kunstreisen und trat selbst auf der Bühne auf. Nach der Scheidung lebte er in Hamburg und Leipzig.  Christof Friedrich Kölle, geb. 1781 in Stuttgart, war 1809 als württembergischer Legationssekretär nach Karlsruhe gekommen, wo er, literarisch interessiert und selbst schriftstellernd, bald in nähere Beziehung zu Hebel trat. Letzterer hat ihn zum „Adjunkten", einer stehenden Figur des Rheinländischen Hausfreundes, gemacht. Er starb 1848, nachdem er zu der 1843 erscheinenden Ausgabe der Werke J. P. Hebels ein allerdings mit Vorsicht aufzunehmendes, aber immerhin wertvolles Lebensbild des Dichters beigesteuert hatte.  Karl Friedrich von Baden, Markgraf von Baden-Durlach (1746-1771), Markgraf von Baden (1771-1803), Kurfürst des heiligen römischen Reiches (1803-1806); offiziell "Markgraf zu Baden und Hochberg, Herzog zu Zähringen, des hl. Römischen Reichs souveräner Kurfürst, Pfalzgraf bei Rhein, Landgraf im Breisgau, zu Sausenberg und in der Ortenau usw.", erster Großherzog von Baden (1806-1811); offiziell "Großherzog von Baden, Herzog von Zähringen".  Friedrich David Gräter, Professor am Gymnasium in Schwäbisch Hall, war Herausgeber der Zeitschrift „Braga und Hermode oder neues Magazin für die vaterländischen Altertümer der Sprache, Kunst und Sitten", ab 1802 auch des „Barden-Almanachs der Deutschen".  Georg Friedrich Treitschke, wirkte als Operndichter und Regisseur an der Wiener Hofoper und gab mit Adolf Streckfuß den „Wiener Musenalmanach" heraus.  Johann Daniel Falk, studierte in Halle, wurde durch Wieland in Weimar eingeführt, wo er sich ansässig machte. In jüngeren Jahren trat er hauptsächlich als Satiriker hervor, später widmete er sich philanthropischen Neigungen, so der Erziehung verwaister und verwilderter Kinder. Sein „Taschenbuch für Freunde des Scherzes und der Satire", ein Hort antiromantischer Polemik, erschien 1797. Karl Georg Dümge, auch Carl George Dümgé, * 23. Mai 1772 in Heidelberg´, † 27. Februar 1845 in Karlsruhe war ein deutscher Historiker, Bibliothekar und Archivar. Er habilitierte an der Universität seiner Vaterstadt Heidelberg, wurde dort 1811 Extraordinarius und bekleidete zugleich den Posten des Universitätsbibliothekars. 1814 wurde er Assessor am Generallandesarchiv in Karlsruhe. 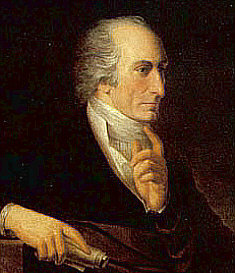 Friedrich Heinrich Jacobi, auch Fritz Jacobi, * 25. Januar 1743 in Düsseldorf, † 10. März 1819 in München) war ein deutscher Philosoph, Wirtschaftsreformer, Kaufmann und Schriftsteller und von 1805 - 1812 Präsident der Akademie der Wissenschaften in München.  Jean Paul [Richter] (eigentlich Johann Paul Friedrich Richter), war ein deutscher Schriftsteller. Er steht literarisch gesehen zwischen Klassik und Romantik. Die Namensänderung geht auf Jean Pauls große Bewunderung für Jean-Jacques Rousseau zurück.  Justinus Andreas Christian Kerner, ab 1850 von Kerner, * 18. September 1786 in Ludwigsburg, † 21. Februar 1862 in Weinsberg war ein deutscher Arzt, medizinischer Schriftsteller und Dichter.  Christoph August Tiedge, * 14. Dezember 1752 in Gardelegen; † 8. März 1841 in Dresden) war ein deutscher Dichter., Schriftsteller in Dresden.  Heinrich Zschokke, der aus Magdeburg stammende Schweizer Staatsmann und Schriftstellerveranlasste 1803 den Basler Buchhändler Samuel Flick, der sich im selben Jahr die Erstausgabe der "Alemannischen Gedichte" hatte entgehen lassen, zur Gründung einer Filiale in Aarau. Ihr Leiter und späterer Besitzer war sein Teilhaber Heinrich Sauerländer. Dort erschienen seit 1805 Zschokkes "Schweizer-Boten-Kalender", das Vorbild des "Hausfreunds" und 1820 die endgültige Ausgabe der "Alemannischen Gedichte".  Johann Michael Zeyher (1770—1843), gebürtiger Mittelfranke, erlernte 300 die Gärtnerei in Ansbach und fand erste Beschäftigung in Triesdorf und Ludwigsburg. 1792 kam er als Gärtner der Familie Burckhardt nach Basel, wurde hier botanischer Gärtner der Universität und markgräflich-badischer Hofgärtner. 1794 verheiratete er sich mit Magdalena Petersen, der Tochter des Basler Stadtgärtners Nikolaus Petersen. 1804 berief ihn Karl Friedrich als Nachfolger des Gartenkünstlers Sckell nach Mannheim und Schwetzingen, wo er bald zum Gartenbaudirektor ernannt wurde, dem sämtliche Hof gärten unterstellt waren.  David Freiherr von Eichthal (ursprünglich David Aaron Seeligmann), badischer Hofagent, 1814 von König Maximilian I. von Bayern in den Freiherrnstand erhoben, Großindustrieller, Gründer und Besitzer einer Fabrik für Spinnereimaschinen und Gewehre in St. Blasien. 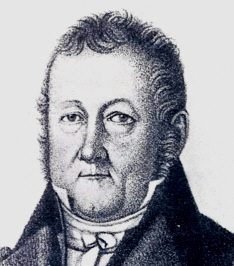 Jakob Friedrich Eisenlohr, ev. Stadtpfarrer und Dekan in Freiburg i. Br.  Daniel-Ehrenfried Stoeber bzw. Stöber, * 9. März 1779 in Straßburg, † 28. Dezember 1835 ebenda, war ein Rechtsanwalt, Notar und Poet, er war ein Verteidiger Elsässischer Traditionen und gilt neben Johann Georg Daniel Arnold als einer der wichtigsten Schöpfer des elsässischen Theaters. Heinrich Wilhelm Maximilian Geyer von Geyersberg, Bruder der Reichsgräfin von Hochberg (der zweiten Gemahlin des Großherzogs Karl Friedrich), 1788 - 1806 kurfürstlich badischer Oberstallmeister.  Johann Jeremias Herbster, seit 1769 Faktor, seit 1784 Berginspektor am Bergwerk in Hausen, der wegen Unterschlagung von Geldern des Amtes enthoben und eingesperrt wurde. Deswegen hat Hebel auch ab der 2. Auflage der Al. Gedichte die Widmung weggelassen.  Jakob Christian Benjamin Mohr, 1778 - 1854, Buchhändler, Verleger, 1804-1810/11 Inhaber der vormals Hermannschen Buchhandlung in Frankfurt am Main, seit 1811 in Heidelberg, 1805 Mitgründer und 1822 alleiniger Inhaber der Akademischen Buchhandlung in Heidelberg. Georg Friedrich Dreuttel, geb. 1752 in Efringen, wurde, nachdem er die Pfarreien Wieslet (1779), Hertingen (1789) und Haltingen (1794) innegehabt hatte, 1799 als Stadtpfarrer nach Schopfheim berufen. 1805 ging er nach Müllheim, wurde 1810 Dekan und starb 1825. Er zählte zu Hebels engerem Bekanntenkreise und wird in diesem meist als Vetter Oswald bezeichnet.  Christian Carl André, * 20. März 1763 in Hildburghausen, † 19. Juli 1831 in Stuttgart war ein deutscher Pädagoge, Landwirt, Journalist, Komponist und Volksaufklärer. Christian Wilhelm Köster, 1766 - 1803 oder 1806, war um 1802 ev.-luth. Pfarrer in Eppingen. Karl August Gysser, geb. 1759, war bis 1794 Bergsekretär in Müllheim, dann Renovator bei der dortigen Schätzungskommission mit dem Titel Rechnungsrat, 1809 als Rat an das Kammerpräsidium in Freiburg versetzt. 1811 erfolgte die Ernennung zum Kreisrat in Offenburg. Dort starb er am 7. Juli 1820. Jakob Friedrich Ringer, 1766 - 1817, Kameralschreiber (Verwaltungsbeamter) in Konstanz, Sohn des Jakob Friedrich Ringer, Pfarrer in Wies. |
 Johann Heinrich Voß (* 20. Februar 1751 in Sommerstorf; † 29. März 1826 in Heidelberg) war ein deutscher Dichter, Übersetzer und Hochschullehrer. Berühmt ist er für seine Übertragungen von Homers Epen (Ilias, Odyssee) und anderer Klassiker der Antike.  Ignaz Heinrich Freiherr von Wessenberg, seit 1798 Domherr, seit 1802 Generalvikar und Bistumsverweser des Bistums Konstanz, Führer einer kirchlichen Reformbewegung mit dem Ziel einer deutsch-katholischen Kirche. Als Mitglied der Badischen Ersten Kammer sind sich Hebel und Wessenberg auch persönlich näher gekommen. Karl Friedrich Ludwig Sonntag, Diakonus und Präzeptor in Lörrach. Karl Ludwig Sonntag, * 1796 in Bötzingen; † 1840 in Badenweiler. Diakonus in Schopfheim und Pfarrer in Hausen i. W. Sebastian Engler, 1761 - 1850, u. a. Pfarrer in Schopfheim und Hausen i. W.  Johann Georg Lenz, * 2. April 1748 in Schleusingen, † 28. Februar 1832 in Jena war ein deutscher Mineraloge, Bergrat und Professor für Mineralogie an der Universität Jena.  Josef Albert von Ittner, (1754—1825), seit 1786 Kapitelkanzler des Malteserordens in Heitersheim, nach dessen Aufhebung im badischen Staatsdienst, 1807 Kurator der Universität Freiburg, zugleich bad. Gesandter in der Schweiz, Mitarbeiter der von J. G. Jacobi herausgegebenen „Iris" und der „Erheiterungen" Zschokkes. Von 1812 bis zu seinem Tode Direktor des Seekreises in Konstanz. Theodor Friedrich Volz, Kirchenrat in Karlsruhe.  Ernst August Klingemann, 1777 - 1831, Schriftsteller (Künstlername Bonaventura) und Hoftheaterintendant in Braunschweig Heinrich Karl Brönner, Verlagsbuchhändler in Frankfurt a. Main.  Johann Leonhard Hug, auch Pseudonym: Thomas Hugson, * 1. Juni 1765 in Konstanz, † 11. März 1846 in Freiburg im Breisgau) war ein römisch-katholischer Theologe und Orientalist. Nussbaumer, Vorname unbek., Frau des Medizinalrates Georg Nußbaumer in Karlsruhe. August Gottlieb Preuschen, * 1734 in Diethardt, † 24. März 1803 in Karlsruhe.Theologe, Kartograph und Geologe. 1771 Hof- und Stadtdiakon in Karlsruhe. 1792 Kirchenrat. In seiner Zeit als Diakon in Schopfheim hatte er einen begabten Lateinschüler: Johann Peter Hebel. Dieser lebte dann auch in Karlsruhe vier Jahre im Haus des Pfarrers. Preuschen verfasste theologische und seit 1776 auch geologische Werke und erfand den Landkartendruck mit Typen.  Heinrich Medicus, 1743 — 1828, zuerst in preußischen, dann in badischen Diensten, war Kavallerieoffizier und nahm 1808 als Oberst seinen Abschied. Er zog sich nach Lichtenau im Hanauerland zurück, um dort seinen schriftstellerischen und volkswirtschaftlichen Interessen zu leben.  Johann Georg Müller, Staatsmann, Politiker und Schriftsteller in Schaffhausen. Hebel hatte ihn auf seiner Schweizerreise am 25. August 1805 besucht. Ehrhard Christian Eccard, 1758 - 1839, Pfarrer in Kleinkems. Christian Gottfried Frantz, *7. September 1761 als Sohn des Pfarrers Johann Frantz und seiner Frau Maria Dorothea, geb. Goll, in Straßburg. Studierte Theologie. Von 1795—1803 wirkte er als Pfarrer in Pfulgriesheim, 1803—1806 in Fürdenheim. 1806 wurde Frantz Pfarrer an St. Wilhelm in Straßburg. Hebel war spätestens 1805 durch die Straßburger Freunde mit Frantz, dessen Frau Sophie Charlotte eine geb. Schatz war, bekannt geworden. Zwischen beiden Männern knüpften sich bald die Bande freundschaftlicher Beziehungen. Diese führten auch zu einem Briefwechsel, von dem, außer dem hier veröffentlichten Fragment, nichts mehr erhalten blieb. Hebel hat auf Anregung von Frantz öfters versucht, badische Kandidaten zur Vertretung und Aushilfe für den elsässischen Pfarrdienst zu gewinnen. Auf welche Schwierigkeiten man dabei stieß, zeigt dieses Schreiben, leider nur ein Teil eines Briefes, der sich im Jahr der Erstveröffentlichung (1884) im Besitze der Witwe eines Professors D. Bauer (Straßburg) befand. Seitdem ist der Brief verschollen. Frantz starb am 1. August 1826 in Straßburg. Daniel Schneegans (1778-1842) und dessen aus Frankfurt am Main stammender Frau Marie Karoline, geb. Schwarz. Daniel S. war Waisenhausdirektor und Geschäftsmann in Straßburg.  Johann Georg Christian Kapp, * 18. März 1798 in Bayreuth, † 31. Dezember 1874 in Neuenheim (heute Stadtteil von Heidelberg) war ein deutscher Professor der Philosophie und demokratisch gesinnter badischer Politiker im Umfeld der Märzrevolution. Markus Theodor von Haupt, * 2. Februar 1782 in Mainz, † 12. Juni 1832 in Paris. Deutscher Jurist und Schriftsteller. Er vermittelte Henriette Hendels Gastspiel 1809 in Karlsruhe, wohin er sie auch begleitete und dabei Hebels Bekanntschaft machte. Simon Gassner, 1755 – 1830, wurde 1808 als Hoftheatermaler von Wien nach Karlsruhe berufen. Markus Fidelis Jäck, 1768 - 1845, * in Konstanz. Pfarrer in Triberg und Kirchhofen, zuletzt Domkapitular in Mainz. War der Empfänger einer Versepistel, nachdem er sich bei Hebel nach der Zusendung der al. Ged. mittels einer Flasche Kirschwasser bedankt hatte. 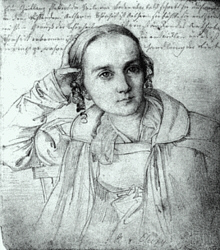 Helmina von Chézy, auch Helmine v. Chezy, geb. von Klencke, auch Sylvandra, eigentl. Wilhelmine Christiane de Chézy, * 26. Januar 1783 in Berlin, † 28. Januar 1856 in Genf war eine deutsche Journalistin, Dichterin und Librettistin. In ihrer Dichtung war Chézy der romantischen Schule verhaftet.  Karl Philip Conz, Jugendfreund Friedrich Schillers. Diakonus in Vaihingen und Ludwigsburg. Die Bekanntschaft mit Hebel dürfte Friedrich Kölle vermittelt haben. Michael Friedrich Wild, der am 8. Februar 1747 geborene Sohn des Bürgermeisters von Durlach Adam Wild und seiner Frau Dorothea, geb. Uhland. Wilds Mutter (1721—1750) war eine Großtante des Dichters Ludwig Uhland. Wild wurde Kameralbeamter in Müllheim. 1806 mit der Untersuchung und Ordnung der Maße und Gewichte im Großherzogtum Baden beauftragt, legte er das Ergebnis seiner Forschungen in dem Buche „Über allgemeines Maß und Gewicht" Freiburg 1809 nieder. 1809 wurde Wild der Titel Hofrat, 1818 Geh. Hofrat verliehen. Er starb am 2. April 1832 in Müllheim.  Friedrich Creuzer, Professor der Philologie und alten Geschichte an der Universität Heidelberg. Sievert, Karl Friedrich, zählt zu Hebels engerem Freundeskreis. 1758 als Sohn des Pfarrers Karl Wilhelm Sievert in Eggenstein geboren, besuchte er vom nahen Grötzingen aus, wohin sein Vater 1764 versetzt worden war, das Karlsruher Gymnasium. Hier dürfte er, obwohl er sich eine Klasse über ihm befand, mit Hebel bekannt geworden sein; aus dieser Schulfreundschaft stammt wohl auch das beide Männer verbindende brüderliche Du. 1779 legte Sievert das Staatsexamen ab und war während der Hertinger Jahre Hebels Präzeptor in Kandern (1782/83), bis er die Pfarrei Gondelsheim erhielt. 1805 wurde Sievert Pfarrer und Dekan des Kirchenbezirks in Schopfheim, schied jedoch nach einigen Unstimmigkeiten 1812 aus diesem Amte. Er bezog die Pfarrei Gutach, übernahm 1821 das Dekanat des Kirchenbezirkes Hornberg, das er bis 1837 versah. 1833 zum Kirchenrat ernannt, starb Sievert 1842 in Gutach.  Friedrich Adolf Krummacher, * 13. Juli 1767 in Tecklenburg, † 4. April 1845 in Bremen war ein deutscher evangelischer Theologe, 1768 - 1845, 1824 - 1842 Stadtpfarrer - St. Ansgarii - in Bremen. Ernst Ludwig Gockel, 1791 - 1835, Pfarrer in Tiengen bei Freiburg. August Heinrich Wieland, geb. 30.8.1795, gest. 3.8.1833 Hardwald bei Muttenz/Pratteln, ref., von Basel. Sohn des Johann Heinrich, Bürgermeister, und der M. M. Schweighauser. Heirat 1819 Barbara Landerer von Basel. Schulen und Beginn eines Studiums in Basel. Bei den Basler Truppen Ausbildung zum Artillerieoffizier, Karriere bis zum Major 1831 und Oberinstruktor der Artillerie. Mit seinem Vater am Wiener Kongress 1815. Inhaber der Schweighauserschen Buchdruckerei und Buchhandlung ab 1821; Universitätsbuchdrucker. Mitglied des Grossen Rats ab 1821 und des Kriminalgerichts ab 1825.  Johann Christof Friedrich Haug, Hofrat und Bibliothekar in Stuttgart, Mitarbeiter in der Redaktion von Cottas "Morgenblatt". Joseph Engelmann, * 28. Mai 1783 in Bacherach, † 13. September 1845 in Wachenheim war ein deutscher Verleger und Buchhändler in Heidelberg.  Heinrich Eberhard Gottlob Paulus, * 1. September 1761 in Leonberg, † 10. August 1851 in Heidelberg war ein evangelischer Theologe, der seit 1790 als Hauptvertreter des theologischen Rationalismus gilt. Gleichwohl trat er auch mit einer judenfeindlichen Denkschrift hervor, in der er sich gegen die rechtliche Gleichstellung der Juden wandte.  Friedrich Christoph Perthes, 1772 - 1843, der Begründer des bekannten Verlages, bis 1822 in Hamburg, danach in Gotha. Gottlieb Ludwig Jakob Schmidt, geb. 1758 in Tübingen, war zuerst in kurpfälzischen und württembergischen Pfarrdiensten. Als Dekan in Hornberg zog er sich die Ungnade der württembergischea Krone zu und wurde beim Übergang Hornbergs an Baden entlassen. 1811 kam Schmidt als Pfarrer nach Britzingen, 1823 nach Willstätt, wo er nach Jahresfrist gestorben ist.  Christian Friedrich Winter, 1773—1858, gründete nach seiner Obersiedlung von Heilbronn nach Heidelberg 1815 die C. Wintersche Universitätsbuchhandlung. Seit 1819 vertrat Winter die Stadt Heidelberg im ersten badischen Landtag. Christian Theodor Wolf, geb. 1765 in Grünstadt (Rheinlandpfalz), zuerst Pfarrer in Hochspeyer, von wo ihn die Französische Revolution vertrieb, seit 1795 Hilfsprediger in Heidelberg, 1796 lutherischer Pfarrer, 1797 kurpfälzischer Konsistorialrat. Nach Anfall der rechtsrheinischen Pfalz an Baden wurde Wolf 1803 zum badischen Kirchenrat ernannt, 1807 erhielt er die 1. lutherische Pfarrei in Heidelberg. Gemeinsam mit Hebel und Sander trug der Dekan des Kirchenbezirkes Heidelberg Entscheidendes zum Einigungswerk der Union (1821) bei. Er starb am 11. März 1848. Wilhelm Weiss, seit 1811 Geh. Kabinettsekretär des Großherzogs mit dem Titel Regierungsrat, 1824 Geh. Hofrat.  Heinrich Schreiber, Professor am Freiburger Gymnasium und Redakteur des Freiburger Wochenblattes.  Johann Georg Scheffner, 1736 - 1820, Lyrischer Dichter und Übersetzer in Königsberg. Als solcher veröffentlichte er „Hebels alemannische Lieder umzudeutschen versucht", Königsberg 1811, und hatte sein Werk am 18. April mit einem Begleitschreiben an Hebel gelangen lassen.  Franz Xaver Mezler, * 3. Dezember 1756 in Krozingen, † 8. Dezember 1812 in Sigmaringen, war ein deutscher Mediziner.  Karl Philipp Kayser, * 18. November 1773 in Enzheim bei Alzey, † 18. November 1827 in Heidelberg war ein deutscher Klassischer Philologe.  Cotta, Johann Friedrich, später geadelt zu Johann Friedrich Freiherr Cotta von Cottendorf , * 27. April 1764 in Stuttgart; † 29. Dezember 1832 in Stuttgart, war ein deutscher Verleger, Industriepionier und Politiker. Bei ihm erschienen das "Schatzkästlein" - der Titel geht auf seinen Vorschlag zurück - und die "Biblischen Geschichten". |
|||
|
zurück zu den Einzel-adressaten |
Die Auswahl der o. a. Informationen orientiert sich
u. a. an: Wikipedia Johann Peter Hebel: Briefe; ausgewählt und eingeleitet von Wilhelm Zentner; C. F. Müller, Karlsruhe & Langewiesche-Brandt, Ebenhausen bei München, 1976 Bilder: Wikipedia, veröffentlicht als "gemeinfrei". |
||||
 zurück zur Briefübersicht
|
|||||